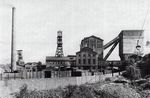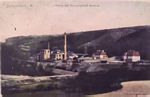Zeche Alte Haase in Sprockhövel
1716 - 1969
Die Zeche Alte Haase war die letzte große Zeche südlich der Ruhr. Sie konnte sich relativ gut bis
zum Beginn der im Prinzip in den 1920er Jahren einsetzenden Krise des Bergbaus im Ruhrgebiet halten. In der Berechtsame
gab es keine Kokskohle und nur drei Flöze waren abbauwürdig. Deren Kohle war Jahrhunderte lang im Umfeld gut absetzbar,
da sie in den zahlreichen Schmieden eingesetzt wurde. Die Fördermenge lag aber nur bei 1000 bis 2000 Tonnen im Jahr.
Später war die Kohle als Hausbrand sehr gefragt. So entwickelte sich Alte Haase im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts
zu einer mittelgroßen Zeche. Als Ende der 1950er Jahre das Heizöl die Kohle verdrängte, begann der Niedergang der Zeche.
Bis zum Ende von Alte Haase bestanden drei Förderstandorte und zuletzt mehrere Außenschächte. Das Grubenfeld vergrößerte
sich durch den Ankauf der angrenzenden Stollenzechen, die nicht zum Tiefbau übergegangen waren. Der Gang in die Tiefe wie
bei den im Norden liegenden Zechen war nicht möglich. Hier stehen die untersten Flöze des Ruhrgebiets an. Mit der Übernahme
von Blankenburg und Ver. Hammerthal im Jahr 1940 reichte das Grubenfeld bis nach Hattingen. Es war das größte im
südlichen Ruhrgebiet und übertraf viele Tiefbauzechen weiter nördlich.
Der Zechenname stammt aus einer Phase, in der das Oberbergamt wegen vieler unbenannter Stollenzechen eine Namensgebung
vorschrieb. Dabei sollten möglichst Tiernamen benutzt werden. So konnten bei Rechtstreitigkeiten die Parteien klar benannt
werden.
Es gab nur einen Vorgängerbetrieb im Bereich der Hauptanlage. Die Zechen im Umfeld waren oft aus einer großen Zahl von kleinsten
Stollenbetrieb durch Konsolidierung entstanden.
Hase
Wahrscheinlich schon im 17. Jahrhundert erfolgte die Verleihung von Hase und ein Abbau begann nahe der Halter Egge. 1716 wurde das Grubenfeld als Alte Haase neu verliehen.
Junger Hase
Im 18. Jahrhundert in den Betriebsakten einmal erwähnt, weiter nichts bekannt.
Alte Haase I
Es fällt auf, dass schon um 1850 durch belgisches, englisches und französisches Kapital eingesetzt wurde. Der Übergang zum Tiefbau erfordere erhebliche Investitionen für die Tiefbauschächte, Tagesanlagen, Kohlenwäschen, Vorrichtungen und Infrastruktur. Die 1884 hier eröffnete Eisenbahnlinie Hattingen - Wuppertal Wichlinghausen, die wenige 100 m neben der neuen Zechenanlage vorbeiführte, war eine gute Vorraussetzung. Schon 1899 wurden vom Mülheimer Unternehmer und Bankier Leo Hanau alle Kuxen (Anteile) der Gewerkschaft Hoffnungsthal in die neugegründete S.A des Charbonnages Westphaliens (Westfälische Kohlenwerke AG) mit Verwaltungssitz und Betriebsstätten (21 Hektar Grundbesitz) in Bredenscheid bei Hattingen eingebracht. Hanau erhielt für die von ihm gehaltene Gewerkschaft Hoffnungsthal im Gegenzug 8333 Aktien und die 25000 Genussscheine der Gesellschaft - in diesem Fall eine Fehlinvestition.
1850 begann der Betrieb von Hoffnungsthal in kleinen Stollen. 1853 wurde ein Hauptförderstollen angelegt, der knapp 465 m Länge erreichte. 1862 wurde der Betrieb eingestellt. Bis 1881 scheiterten mehrere Versuche eines Neuanfangs. Dieser kam 1889 mit dem Abteufen von Schacht 1, der eine flache Teufe von 170 m erreichte. 1893 wurde eine Brikettfabrik gebaut und 1896 die maximale Förderung von 25896 t mit 94 Beschäftigten erreicht. Die Kohle wurde bis zur Stollensohle gehoben und im Stollen mit Pferdeförderung zu Tage gebracht.
1897 wurden Nachbarzechen übernommen (Wodan, Schwarze Rabe) und im Jahr darauf ein neuer seigerer Schacht 2 abgeteuft. Die Brikettfabrik an diesem Standort ging in Bau, aber erst 1903 in Betrieb. Die Förderung begann im Jahr 1900 nach dem Durchschlag mit Schacht 1. Dieser wurde 1901 zusammen mit der Brikettfabrik aufgegeben.
Ab 1899 bestand unter den Namen Westfälische Kohlenwerke ein Verbund mit den noch selbständigen Zechen Rabe und Wodan. Die Fusion war im Jahr 1902. Jetzt wurde die gesamte Förderung im Schacht Hoffnungsthal 2 gehoben. 1904 erreichte die Förderung 99970 t bei einer Belegschaft von 471 Bergleuten.
Ab 1905 hieß die Zeche nach einem Besitzerwechsel Johannessegen. Die Förderung lag bei 100000 - 130000 t/a mit dem Maximum von 144502 t im Jahr 1906. 1921 wurden die zerstückelten Anlagen (zwei Schächte, acht Tagesüberhauen und fünf Stollen) zu Alte Haase I konsolidiert. Diese Anlage wurde schon 1925 wegen der Krise im Bergbau stillgelegt. Die Tagesanlagen wurden abgebrochen und die Grubenbauten soffen ab. 1934 begann der Abbau von Alte Haase II aus erneut. Die wirtschaftlich gewinnbaren Vorräte waren wahrscheinlich spätestens um 1950 herum abgebaut. Die Zechenziegelei blieb noch weiter in Betrieb. Der größte Teil der Betriebsanlagen liegt heute unter der hier angelegten Müllkippe. Die ausführliche Entwicklung ist weiter unten beschrieben.
Alte Haase II
Bis zur Förderaufnahme im Schacht 1 (Julie) wurde schon umfangreicher Abbau im Gesenk bis zu einer Teufe von 235 m betrieben. Damit bestand ein hohes Risiko beim Grubenwasser, da eine Wasserhaltung in einem Tagesschacht effektiver ist als im Stollen. 1837 soff die Grube ab und kam erst 1860 wieder in Betrieb.
Die Förderung stieg mit dem Bahnanschluss im Jahr 1890 sprunghaft auf etwa das Zehnfache an und die 1891 in Betrieb genommene Brikettfabrik sorgte für eine weitere Steigerung. 1898 wurden die Tagesanlagen modernisiert. Der Schacht 2 ging 1924 in Betrieb. Er hatte eine Schachthalle, die stilistisch an einen Malakoffturm erinnert. Fälschlisch wird er auch gerne so bezeichnet. Die Zeit der Malakofftürme war etwa von 1860 bis 1880, als der Bergbau nach Norden vorrückte und wegen größerer Teufen standfeste Förderanlagen brauchte. Bis Eisengerüste betriebstechnisch sicher waren blieben gemauerte Türme Stand der Technik.
Nur ein Jahr nach der Förderaufnahme in Schacht 2 sollte die Zeche wegen Absatzmangel stillgelegt werden. Die Belegschaft sorgte mit unbezahlten Schichten dafür, dass die Anlage nicht absoff und betriebsbereit blieb. Die Stadt Sprockhövel hätte ihren wichtigsten Steuerzahler verloren und auch viele ansässige Zulieferer gerieten in existentielle Nöte. Im April 1926 gelang die Wiederinbetriebnahme. Der Besitzerwechsel (VEW) einen Monat später, war sicher auch auf politischer Ebene betrieben worden. Er sicherte die weitere Existenz durch den Bau einer Seilbahn ab 1926 zum Kraftwerk Hattingen. Ein Jahr nach der Inbetriebnahme (1929) erreichte Alte Haase die maximale Förderung. Die Seibahn war bis 1964 in Betrieb.
Um 1950 zeigten sich die Nachteile der ungünstigen Geologie. Die Abbaubetriebe waren bis zu sieben Kilometer von den Schächten entfernt und durch das fehlende Deckgebirge gab es im Herbst bis zu 20 m³/min Wasserzuflüsse. Weiter nördlich waren es nur wenige m³. Um die Kosten zu senken wurden Außenanlagen eingerichtet. Als erster 1952 der Schacht Brahm. Er war Seilfahrtschacht und verkürzte die Anfahrtszeiten unter Tage deutlich. Die Kohle wurde unter Tage zur Anlage 1/2 gebracht. Dieser Transport blieb teuer. Als Ausweg wurden die Anlagen Niederheide und Buchholz angelegt. Die geförderte Kohle ging mit LKW zur Aufbereitung an Schacht 1/2.
Am Schacht Niederheide war die geologische Situation im Vergleich sehr günstig. Die beiden besten Flöze (Hauptflöz und Wasserbank) war hier oberflächennah flach gelagert und ermöglichten maschinellen Abbau. Dieserverursachte im Umfeld schwere Bergschäden. Kurzfristig war der Betrieb mit ca. 1100 t/Tag einer der produktivsten im Ruhrgebiet. Die Gesamtförderung von Alte Haase stieg um ein Drittel an. Da die Lagerung nur in einem kleinen Bereich wie erhofft angetroffen wurde gingen die Kosten schnell in die Höhe und führten zur Stillegung im Jahr 1969. Zur Anlage gehörte ein kleiner Luftschacht.
Nördlich von Niederheide befand sich die Kleinzeche Johanna. Sie begann 1956 mit der Förderung und erreichte 1958 das Maximum von 10162 t. Bis zur Stilllegung 1964 wurden 7000 - 9700 t/a gefördert. Die Betriebsfläche ist renaturiert.
1966 wurde die Förderung am Schacht 1/2 eingestellt und nur noch die Aufbereitung weiter betrieben. Die Brikettfabrik wurde Ende 1967 stillgelegt. Die meiste Kohle wurde als Hausbrand abgesetzt, der aber rapide zurück ging. Ende April 1969 wurde Alte Haase stillgelegt.
Von den Anlagen sind noch einige Gebäude erhalten. Auf Alte Haase II die Schachthalle und die angrenzenden Werkstatt-/Verwaltungsgebäude. Auch das Kesselhaus steht noch und daneben der Kaminstumpf. Er ist mit dem Material des gekürzten Kamins aufgefüllt. Der Stollen zu den ehemaligen Absetzbecken ist noch offen. Hier liegt noch teilweise die Rohrleitung der Wasserhaltung. Von den Absetzbergen wurde Kohlenschlamm im Stollen zu einer Nebenförderung am Schacht 1 gebracht und der Kesselkohle im Kraftwerk beigemischt, um den Brennwert zu senken. Mit fast Anthrazitqualität brannt sie so heiss, das die Roste und Dampfrohre stark gelitten hätten. Im Stollen werden seit einiger Zeit auch Führungen angeboten. Näheres dazu unter Bergbauaktiv Ruhr zu finden.
Am Schacht Brahm ist das Kauen-/Betriebsgebäude zu Wohnungen umgebaut worden. Das Fördermaschinengebäude am Schacht Niederheide ist zu einem Wirtschaftsgebäude des hier entstandenen landwirtschaftlichen Betriebs umgebaut. Am Schacht Buchholz wurden die Gebäude (Büro, Waschkaue, Kohlebunker und Fördermaschinenhaus) abgerissen. Hier ist heute ein Lagerplatz der städtischen Betriebe Hattingen. Das Gelände am Wetterschacht ist renaturiert.
Alte Haase III
Harmonie
1760 wurde ein Längenfeld verliehen. Erst 1838 begann der Abbau mit 1700 - 3700 t jährlich. Von 1854 bis zum vermutlichen Abbauende 1869 gab es viele Unterbrechungen. Das Feld ging um 1873 an Elisabethenglück und 1908 an Ver. Adolar.
Sunderbank
1785 wurde das Feld vermessen, 1821 verliehen und 1854 der Betrieb aufgenommen. Zusammen mit Ver. Verborgenglück ab 1855 wurde aus dem Stollen gefördert, wobei formal beide Betriebe selbstängig waren, obwohl sie als Sunderbank & Ver. Verborgenglück geführt wurden. 1859 brach ein Grubenbrand aus. Ab 1861 wird Sunderbank nicht mehr genannt, Ver. Verborgenglück bestand noch bis mindestens 1865. 1907 ging das Feld an Ver. Adolar.
1903 soffen die Grubenbaue ab. 1905 konnte der Betrieb nach dem Sümpfen wieder aufgenommen werden. Der ab 1906 geteufte seigere Schacht 2 ging 1909 in Förderung. Durch Zukauf von stillgelegten Nachbarzechen wurde die Berechtsame stark erweitert und 1910 die Konsolidation zu Glückauf Barmen durchgeführt. Ab 1907 bestand eine Schmalspurbahn zum Bahnhof Hiddinghausen. Die Kohle wurde bis zur Höhe der Halde in einem offen tonnlägigen Schacht transportiert und dort umgeladen. 1912 wurde die Bahn überflüssig, da die Kleinbahn Bossel - Blankenstein den Betrieb aufnahm.
Die Förderung von knapp 40000 t/a stieg bis 1913 auf 119050 t (Maximum) und lag bis zur Konsolidation zu Alte Haase III im Jahr 1921 bei durchschnittlich 73000 t jährlich. Es wurde eine Brikettfabrik betrieben. 1924 wurde die Anlage stillgelegt und soff ab. Die Tagesanlagen wurden abgebrochen. Ab 1934 begann im Grubenfeld wieder der Abbau bis 1966, als der Schacht Brahm abgeworfen wurde.
Heute befindet sich auf einem Teil der Betriebsfläche ein landwirtschaftlicher Betrieb. Von der früheren Nutzung ist nichts mehr zu erkennen. Erhalten sind die Direktorenvilla und das Steigerhaus.
1951 gegann die Kleinzeche Glückauf Barmen mit dem Kohleabbau. Sie förderte 9561 - 14358 t/a, 1954 maximal 14409 t. Der Betrieb endete 1958. Die von 1958 - 1963 betriebene Kleinzeche Glückauf Barmen II erreichte 1960 4129 t.
Hoffnungsthal / Johannessegen
Die spätere Zeche Johannessegen enstand im Wesentlichen aus drei Stollenbetrieben, die im Jahr 1897 zu Hoffnungsthal konsolidierten. Dazu kamen neben den weiter getrennt betriebenen Zechen Wodan (bis 1901) und Schwarze Rabe (bis 1902) fünf weitere Grubenfelder. Die ziemlich unübersichtliche Geschichte der Zeche wird hier soweit möglich chronologisch beschrieben. Als Übersicht ist der Zechenstammbaum als PDF zum Download hinterlegt. Von den Betrieben sind bis auf wenige Geländekanten oder Haldenreste keine Hinweise erhalten. Nebenbei zeigt die Chronologie, dass bei den Zechennamen sehr viel Fantasie herrschte.
Hülsiepenbank
1684 wurde ein Längenfeld verliehen. Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts gab es bis 1812 einen oft unterbrochenen Abbau mit 600 - 800 t Kohleabbau jährlich. Ab 1874 begann ein neuer Betrieb, der mit der Übernahme durch Hoffnungsthal im Jahr 1893 endete. Die Fördermenge war etwa dreimal so hoch wie in der ersten Betriebsphase.
Johannessegen
1793 wurde ein Längenfeld verliehen. Erst ab 1874 wurde ein Stollen angelegt, der 1887 eine Länge von rund 800 m erreichte. Die Förderung lag bei 700 - 900 t jährlich. 1890 wurden 3579 t erreicht. 1887 ging eine Schleppbahn zum Bahnhof Bredenscheid in Betrieb. 1895 endete der Betrieb und 1897 folgte die Konsolidation zu Hoffnungsthal.
Wodan
Ab 1845 wurde zwei Stollen betrieben. 1854 wurde ein neuer Förderstollen nach Westen aufgefahren. Er erhielt 1856 Erbstollenrechte bei einer Länge von knapp 285 m. Als Wodan Erbstollen sollte er aufgeweitet werden. 1861 waren gerade mal 65 m geschafft. 1864 wurde das Erbstollenrecht aufgehoben. Die Förderung von Wodan lag bei 100 t jährlich. Von etwa 1860 bis 1883 bestand eine Schleppbahn zum Bahnhof Nierenhof. Nach einer Betriebsunterbrechung zwischen 1876 und 1884 startete ein neuer Betrieb mit einer Jahresförderung um 4000 t. Ab 1892 bestand eine Pferdeschleppbahn zum Bahnhof Bredenscheid. Im Jahr 1900 wurde die maximale Förderung von 12943 t erreicht. 1902 wurde Wodan mit Hoffnungsthal und Rabe zusammengelegt und in Westfälische Kohlenwerke umbenannt.
Von 1958 bis 1963 betrieb die Kleinzeche Wodan einen Stollen im Wodantal. 1960 wurden 5285 t gefördert, 1961 5446 t.Schwarze Rabe
Von 1737 bis 1769 bestand ein unbedeutender Betrieb. 1816 wurden Längenfelder neu verliehen und zu Ver. Kuhlenbergerbänke konsolidiert. Diese bestanden bis 1828. 1873 wurde unter dem Namen Rabe wieder Kohle abgebaut. 1874 waren es 4719 t. Eine regelmäßige Förderung begann erst 1888. 1897 wurden 21097 t erreicht, im Jahr 1900 das Maximum von 32887 t. Bis zur Zusammenlegung mit Hoffnungsthal und Wodan im Jahr 1902 war die Zeche ein reiner Stollenbetrieb.
Prinz Wilhelm
Schon im 18. Jahrhundert entstanden, von 1872 bis 1876 geringer Betrieb. 1897 zu Hoffnungsthal.
Gustav Carl
Schon vor 1867 etwas Betrieb. Ab 1870 Benutzung der Schmalspurbahn von Wodan zum Bahnhof Nierenhof. Die Förderung lag bei 5000 - 6000 t/a, maximal 8917 t im Jahr 1873. Von 1878 bis zur Silllegung 1888 lag die Förderung bei etwa 600 t/a. 1897 zu Hoffnungsthal.
Diedrich Carl
Vor 1864 ist ein Betrieb bekannt. 1897 zu Hoffnungsthal.
Siegeskranz
Nach der Verleihung 1846 gab es kurze Zeit einen Betrieb. 1897 zu Hoffnungsthal.
Jolousie
Belege für einen Abbau zwischen 1869 und 1879 sind bekannt. Von 1845 bis etwa 1880 gab es sporadischen Betrieb mit einigen Hundert Tonnen Kohle jährlich, 1872 wurden 2032 t erreicht. 1897 zu Hoffnungsthal.
Redlichkeit
Der Stollenbetrieb bestand nur von 1890 bis 1891 (390 t / 360 t). 1899 Erwerb durch Westfälische Kohlenwerke.
Geduld
Nach der Verleihung 1826 begann im folgenden Jahr der Betrieb. Gefördert wurde zeitweise in tonnlägigen Schächten. 1892 wurden 1743 t erreicht. Bei der Stilllegung 1892 waren es 1400 t. 1900 Erwerb durch Westfälische Kohlenwerke.
- Erwerbungen durch Westfälische Kohlenwerke.
Friedliche Nachbar
1816 wurde ein Stollen aufgefahren, um Eisenstein abzubauen. 1817 wird er nicht mehr erwähnt. 1837 wurde ein Aufwältigungsversuch nach vier Monaten beendet. Ab 1838 begann das erneute Auffahren als Cornelius Erbstollen. Er hatte bis 1842 kein Flöz aufgeschlossen und wurde endgültig 1861 aufgegeben. Von 1864 bis 1872 gab es eine weitere Betriebsphase, bei der auch die Schleppbahn zum Bahnhof Nierenhof genutzt wurde. Die Förderung lag bei 3400 t jährlich, maximal 4486 t im Jahr 1867. Von 1902 bis 1905 wurde noch einmal gearbeitet. 1904 wurde die maximale Förderung von 4963 t erreicht. Nach der Übernahme durch Johannessegen gingen die Kohlen unter Tage dorthin.
1949 wurde der Bezrieb als Kleinzeche Friedlicher Nachbar wieder aufgenommen. 1950 wurden 3181 t gefördert. Nach der Umnenennung in Edelsteinberg I lief der Betrieb noch bis 1962. Die Förderung war relativ hoch. 1952 waren es 12059 t und 1960 36703 t. Das Maximum von 36703 t wurde 1955 erreicht. Ein Teil der Zechengebäude wurde bei dem heute hier betriebenen Hotel Niggemann verwendet.Hohenstein
Verleihung 1855, Betrieb unbekannt. 1906 zu Johannessegen.
Zufälligglück
Verleihung 1838, ab 1857 Lösung und Nutzung durch den Stollen von Braut. Bis 1875 Betrieb mit langen Stillständen. 1874 wurden 1353 t gefördert. 1906 zu Johannessegen.
Johann Heinrich
Verleihung 1846, ab 1899 Abbau - 1900 835 t, 1901 995 t. 1903 stillgelegt und 1906 zu Johannessegen.
Heinrich Wilhelm
Verleihung 1819, ab 1833 Betrieb. Förderung maximal 1265 t im Jahr 1837, sonst 600 - 800 t/a. Nach 1843 kein Betrieb. 1901/02 zu Westfälische Kohlenwerke.
Valeria
1844 Verleihung, ab 1857 Lösung und Förderung durch den Bräutigam Erbstollen bis 1865. Von 1870 bis 1874 noch mal in Betrieb. 18872 wurden 6614 t gefördert. Berechsame 1907 zu Johannessegen.
Pius
1791 Verleihung und nachfolgend Betrieb. 1842 und 1848 Aktivitäten. 1908 zu Johannessegen.
Gute Hoffnung
Nach der Verleihung 1793 Abbau, ebenso im 19. Jahrhundert. 1908 zu Johannessegen.
Medeworth
Verleihung 1850 und vermutlich bis 1855 Betrieb. Nach 1873 Konsolidation zu Rebecca, Medeworth & Raffenburg.
Rebecca
Ab 1867 Wiederaufnahme eines früheren Betriebs. Förderung 1869 1634 t. 1873 Konsolidation zu Rebecca, Medeworth & Raffenburg. Kuxenmehrheit 1908 bei Johannessegen.
Raffenburg
1847 verliehen, eigener Betrieb unbekannt. Nach 1873 Konsolidation zu Rebecca, Medeworth & Raffenburg.
Waterloo
1847 verliehen, eigener Betrieb unbekannt. 1908 zu Johannessegen.
Königsburg
1859 verliehen, eigener Betrieb unbekannt. 1909 zu Johannessegen.
Zukunft
Betrieb unbekannt, 1909 zu Johannessegen. 1956 bis 1958 bestand die Kleinzeche Zukunft, die 1957 4489 t förderte.
Sohn Emil & Tochter Auguste
Verleihung 1848, unbekannt, 1909 zu Johannessegen.
| Schacht | Teufbeginn | Inbetriebnahme | Stilllegung | max. Teufe (m) | Brikettfabrik |
| Alte Haase 1 (Julie) | 1875 | 1875 | 1966 | 291 | 1891 - 1967 |
| Johannessegen 1 | 1889 | 1890 | 1902 | 170 (t) | |
| Johannessegen 2 | 1898 | 1903 | 1925 | 164 | 1903 - 1925 |
| Adolar 1 | 1898 | 1899 | 1924 | 84 / 170 (t) | ca. 1910 - 1924 |
| Adolar 2 | 1906 | 1907 | 1924 | 148 / 300 (t) | |
| Glückauf Barmen | 1909 | 1910 | 1924 | 137 | |
| Rabe W | 1909 | 1910 | 1925 | 45 t | |
| Alte Haase 2 | 1920 | 1924 | 1966 | 311 | |
| Im Brahm | 1950 | 1952 | 1966 | 344 | |
| Niederheide | 1963 | 1963 | 1969 | 270 | |
| Buchholz | 1963 | 1965 | 1969 | 284 | |
| Buchholz W | 1963 | 1965 | 1969 | 14 |
maximale Förderung 476670 t 1938
durchschnittlich 300000 - 400000 t/a
Auch wenn die Förderung der vielen kleinen Stollenvorläufer sehr gering erscheint waren diese Zechen oft sehr profitabel, da sie meistens nur bei Bedarf förderten.